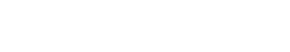Neue EU-Regeln für ESG-Ratings ab Juli 2026
Ab dem Anfang Juli 2026 gilt in der EU erstmals ein einheitlicher Rechtsrahmen für Anbieter von ESG-Ratings. Ziel der neuen Verordnung ist es, die Qualität, Transparenz und Vergleichbarkeit von ESG-Bewertungen deutlich zu verbessern. Für Unternehmen, Investoren und Ratingagenturen markiert diese Regulierung einen Wendepunkt – und einen klaren Schritt in Richtung vertrauenswürdiger Nachhaltigkeitsinformationen.
Warum ESG-Ratings reguliert werden
ESG-Ratings – also Bewertungen zur Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance von Unternehmen – sind in den letzten Jahren zu einem entscheidenden Faktor für nachhaltige Investitionsentscheidungen geworden. Doch bislang fehlte es an einheitlichen Standards: Methodiken waren oft intransparent, ESG-Scores kaum vergleichbar und potenzielle Interessenkonflikte nicht klar geregelt. Das führte zu wachsender Kritik – und zur Gefahr von Greenwashing.
Mit der neuen Verordnung (EU) 2024/3005 begegnet die EU diesem Problem mit einem klaren Regelwerk.
Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick
1. Transparente Methoden, nachvollziehbare Scores
Ratinganbieter müssen künftig offenlegen, wie ihre ESG-Scores berechnet werden: inklusive verwendeter Datenquellen, Gewichtungen und Bewertungsmodelle. Besonders wichtig: ESG-Ratings müssen nach den drei Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung getrennt ausgewiesen werden – inklusive ihrer jeweiligen Gewichtung im Gesamtscore.
2. Strenge Qualitäts- und Integritätsstandards
Anbieter benötigen ab Juli 2026 eine offizielle Zulassung durch die Europäische Wertpapieraufsicht ESMA. Diese prüft, ob interne Strukturen, Prozesse und Unabhängigkeit den Anforderungen entsprechen. Ziel: Interessenkonflikte vermeiden – z. B. durch klare Trennung von Rating- und Beratungstätigkeit.
3. Einheitliche Regeln für alle – auch international
Nicht nur in der EU ansässige Anbieter sind betroffen: Auch ESG-Ratingagenturen aus Drittstaaten müssen bestimmte Anforderungen erfüllen oder mit EU-zugelassenen Anbietern zusammenarbeiten, um in der EU tätig sein zu dürfen.
4. Mehr Vertrauen, weniger Greenwashing
Die neue Verordnung stärkt die Rolle der ESMA als Aufsichtsbehörde. Sie kann nicht nur Lizenzen entziehen, sondern auch Sanktionen verhängen, wenn Anbieter gegen die Vorschriften verstoßen. Damit will die EU das Vertrauen in ESG-Ratings erhöhen – und gleichzeitig dem Greenwashing aktiv entgegenwirken.
Zeitplan: Was wann passiert
Datum
Was passiert?
2. Januar 2025
Verordnung tritt in Kraft
Bis Oktober 2025
ESMA entwickelt technische Standards (RTS)
2. Juli 2026
Neue Vorschriften gelten verbindlich
Bis Nov 2026
Übergangsfrist für bereits tätige Anbieter
Mehr Klarheit für alle Beteiligten
Die ESG-Rating-Verordnung ist ein wichtiger Schritt, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU zu professionalisieren. Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen sich künftig auf fundierte, transparente ESG-Bewertungen einstellen. Für Investoren: bessere Vergleichbarkeit und mehr Sicherheit bei nachhaltigen Finanzentscheidungen. Und für Ratinganbieter: ein klarer Rahmen, der Qualität und Unabhängigkeit fordert – aber auch fördert.
Ein Schritt in Richtung echter Nachhaltigkeit – mit klaren Regeln statt bloßen Versprechen.