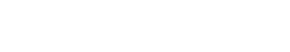Die schönsten Plätze in Österreich & Deutschland: Wo Natur noch tobt und der Mensch aufatmen kann
In einer Zeit, in der viele Erholungsorte durch touristische Übernutzung an Authentizität verlieren, bietet das Gesäuse in der steirischen Bergwelt eine erfrischende Ausnahme: ungezähmte Natur, entschleunigtes Leben, echtes Durchatmen. Als jüngster Nationalpark Österreichs vereint das Gesäuse wilde Schönheit mit bewusstem Schutz. Wer hier Urlaub macht, taucht ein in eine Landschaft, die ihre Kräfte spüren lässt – und dabei respektvoll behandelt werden will.
Schroffe Kalkriesen, rauschende Gebirgsbäche, duftende Wälder und stille Almen prägen die Region – doch es sind nicht nur die Naturschätze, die beeindrucken. Das Gesäuse gilt als Modellregion für nachhaltigen Tourismus, in der Umweltschutz, Regionalentwicklung und Urlaub auf Augenhöhe zusammenspielen. Eine Reise hierher zeigt, wie Zukunft aussehen kann – wenn wir sie behutsam gestalten.
Anreise & Mobilität – Auto stehen lassen erwünscht
Bereits die Anreise ins Gesäuse beweist: Nachhaltigkeit beginnt vor der Haustür. Die Region ist sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden und bietet eine Vielzahl umweltschonender Mobilitätslösungen:
Die Ennstalbahn führt direkt in den Nationalpark – Haltestellen in Admont, Johnsbach, Weng oder Gstatterboden ermöglichen einen einfachen Zugang zu Wanderwegen und Unterkünften.
Regionale Buslinien erschließen auch abgelegenere Dörfer.
Vor Ort stehen E-Bikes, Wanderbusse sowie Shuttleservices zur Verfügung.
Viele Herbergen und Tourismusbetriebe honorieren die Anreise mit Bahn oder Rad – etwa mit vergünstigten Nächten oder geführten Touren. Wer möchte, kann seinen gesamten Aufenthalt komplett autofrei gestalten – ohne dabei auf Komfort zu verzichten.
Übernachten mit Verantwortung
Im Gesäuse schläft man mit Blick auf die Berge – und mit gutem Gewissen. Die Beherbergungsbetriebe der Region setzen vermehrt auf ökologische Standards, regionale Wertschöpfung und einen respektvollen Umgang mit Ressourcen.
Empfehlenswerte Adressen:
Öko-Gasthof zur Bachbrücke – Bio-Küche, Energieeffizienz, Naturgarten
Camping Forstgarten – naturnahes Übernachten mit minimalem ökologischen Fußabdruck
Naturfreundehaus Gstatterboden – einfache Zimmer mit großem Panorama
Viele dieser Betriebe sind Teil von Initiativen wie dem Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen oder tragen Umweltzeichen wie das Österreichische Umweltgütesiegel. Übernachten wird hier zu einer bewussten Entscheidung – für die Region, für die Umwelt und für eine neue Reisekultur.
Aktivitäten – Wildnis hautnah erleben
Wer ins Gesäuse kommt, sucht nicht Entertainment, sondern Erdung. Hier wird Natur nicht inszeniert, sondern erlebt – unmittelbar, ehrlich und oft beeindruckend intensiv:
Die Gesäuse Hüttenrunde bietet eine mehrtägige Trekkingtour durch alpines Gelände, von Hütte zu Hütte, mit atemberaubenden Ausblicken und viel Einsamkeit.
Geführte Naturwanderungen mit Ranger:innen oder Naturpädagog:innen vermitteln Wissen über Biodiversität, Geologie und Klimaentwicklung.
Beim Riverwalking an der Enns lernt man den Gebirgsfluss auf völlig neue Weise kennen – als Lebensader einer Region, nicht als Abenteuerpark.
Ein besonderes Erlebnis ist der „Weg der Wildnis“, ein didaktisch gestalteter Naturlehrpfad, der die ökologischen Zusammenhänge des Nationalparks erklärt und die eigene Wahrnehmung schärft.
Regionale Küche mit Haltung
Im Gesäuse wird nicht einfach gekocht – hier wird mit Bewusstsein genossen. Die kulinarische Kultur ist eng mit der Landschaft verbunden: was hier wächst, wird verarbeitet. Was hier lebt, wird respektvoll genutzt. Der Bezug zur Region ist dabei kein Marketingbegriff, sondern gelebter Alltag:
Wildkräuter aus den Alpentälern,
Ennstaler Almlamm aus extensiver Weidehaltung,
Käse, Milch und Joghurt von Bergbauernhöfen,
Bergfisch aus nachhaltiger Teichwirtschaft.
Viele Gasthäuser und Produzent:innen orientieren sich an den Prinzipien der Slow-Food-Bewegung, pflegen traditionelle Rezepte und achten auf eine faire Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten.
Nachhaltigkeitsfaktor – das Gesäuse als Modellregion
Das Gesäuse steht exemplarisch für eine neue Form von Tourismus, die Naturerleben und Naturschutz verbindet. Hier wurde früh erkannt, dass intakte Umwelt und wirtschaftliches Leben kein Widerspruch sein müssen – im Gegenteil:
Der Nationalpark Gesäuse ist als Schutzgebiet der IUCN-Kategorie II anerkannt – das bedeutet: ökologische Vorrangstellung bei allen Entscheidungen.
Es gibt intensive Kooperationen mit Schulen, Universitäten und der lokalen Bevölkerung – etwa im Rahmen von Citizen Science.
Die Region fördert aktiv nachhaltige Landwirtschaft, Kulturinitiativen und sanfte Mobilitätsformen.
Anstelle von Eventtourismus und Massenangeboten setzt man hier auf Tiefe statt Breite – und schafft so ein Urlaubserlebnis mit echtem Mehrwert.
Fazit – Warum dieser Ort mehr ist als ein Urlaubsziel
Das Gesäuse ist nicht nur eine Destination – es ist ein Statement. Für eine neue Art zu reisen. Für mehr Achtsamkeit gegenüber Landschaft und Lebensweise. Für eine Verbindung zwischen Menschen und Natur, die auf Respekt und Erkenntnis basiert.
Hier spürt man, wie wenig es braucht, um sich reich zu fühlen: eine einfache Hütte, ein weiter Blick, das Rauschen der Enns. Und die Gewissheit, Teil einer Bewegung zu sein, die nicht nur reist, sondern verantwortungsvoll unterwegs ist.
Weitere Informationen:
https://www.steiermark.com/de/Gesaeuse
https://nationalpark-gesaeuse.at/
Nächste Folge:
Die Rhön – Sterne schauen statt Netflix
Eine Region zwischen Bayern, Hessen und Thüringen, die als UNESCO-Biosphärenreservat neue Maßstäbe für nachhaltigen Tourismus setzt.